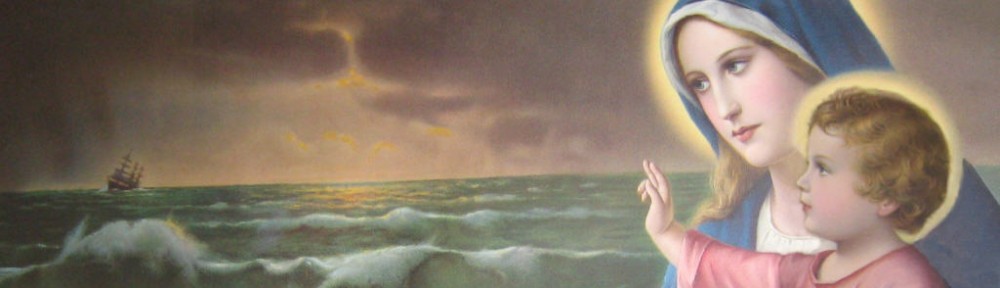Gott beruft immer genug Männer zum Priestertum, davon bin ich fest überzeugt. Das Problem ist also nicht eine zu geringe Zahl an Berufungen, sondern unter den Berufenen eine zu schlechte „Ausbeute“. Die Zahl derjenigen, die zwar eine Berufung hätten, aber niemals davon erfahren, ist einfach zu hoch. Diözesen versuchen schon – erfolglos – seit vielen Jahren, mehr Priesterberufungen zu erlangen. Doch das alles funktioniert nicht richtig. Andererseits ist die Zahl der Neupriester bei der Petrusbruderschaft und anderen traditionell-katholischen Gruppen nur durch den knappen Platz in den Priesterseminaren begrenzt. Das trifft selbst auf die Piusbrüder zu, die nicht einmal eine kirchenrechtliche Stellung haben, und deren Priester allesamt suspendiert werden, sobald ihre Weihe vollzogen ist.
Was machen die traditionellen Gruppierungen richtig, was die Bistümer und der Mainstream der heutigen Kirche falsch machen? Die Frage wird sich wohl niemals wirklich schlüssig lösen lassen. Ich verzichte auf eine ausführliche Analyse oder Herleitung meiner Vorschläge und führe stattdessen ein schlichtes Zehnpunkteprogramm für die Lösung des „Priestermangels“ an. Die meisten dieser Punkte lassen sich auf Gemeindeebene umsetzen, für manche müßte man auf Diözesanebene handeln.
1. Totales Quengelverbot: Die Kirche ist die Kirche; ihre Dogmen sind ihre Dogmen; und fertig. Wer das anders sieht, irrt. Wir stehen für etwas, was nicht jedem gefallen muss, aber wem es gefällt, dem gefällt es so richtig. Es muss klar werden: Hierfür lohnt es sich, sein ganzes Leben umzustellen und gar hinzugeben.
2. Anbetung des Eucharistischen Herrn: Der Herr ist wirklich gegenwärtig im Sakrament des Altares – dieses „Stück Brot“ kann man nur anbeten, wenn man wirklich an die Realpräsenz glaubt, denn sonst hält man es wirklich nur für ein „Stück Brot“. Doch diese reale Präsenz bringt uns der Priester, und nur er.
3. Kinderreiche Familien: Viele Kinder heißt auch viele Söhne, also ein großes potenzielles „Reservoir“ – und einer Priesterberufung zu folgen, wenn man der einzige Sohn einer Familie ist, fällt aus offensichtlichen Gründen deutlich schwerer.
4. Männlicher Altardienst: Sehr viele Priester waren früher Meßdiener. Doch in dem Alter, in dem Jungen diesen Dienst heute in der Regel ausüben, wollen sie nicht viel mit Mädchen zu tun haben. Mädchen zuzulassen heißt, viele Jungen abzustoßen. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Meßdienerinnen und Ordensberufungen, wohl aber zwischen Meßdienern und Priesterberufungen.
5. Respekt vor dem Priester: Keiner will einen Beruf ergreifen, in dem er von seinem engsten Umfeld nicht respektiert wird. Sieht der Jugendliche schon sehr früh, dass der Priester zumindest von den anderen Gläubigen mit Respekt behandelt wird, wird er einer späteren Berufung wesentlich häufiger folgen. Zudem drückt der Respekt vor dem Priester auch Respekt vor seiner unverzichtbaren Handlung am Altar aus.
6. Katechese, Katechese, Katechese: Wer den Glauben nicht kennt, wird auch keine Priesterberufung erkennen und ihr folgen. Dabei darf man keinesfalls unpopuläre Themen aussparen. Sonst kann der Priester ja gleich Politiker oder Medienberater werden – was viele dann auch scheinbar tun. Einen Politikermangel gibt es ja leider nicht.
7. Männliche Priester: Priester sollten sich nicht scheuen, „echte Männer“ zu sein. Sie sind wirklich Väter ihrer Gemeinde. Sie sollten sich auch so verhalten. Viele Priester erscheinen heute aber sehr verweichlicht; in ihrem Verhalten fast androgyn. Kein Wunder, dass die Priesterschaft von Homosexuellen scheinbar nur so wimmelt. Vorbilder sind, gerade für Jugendliche, sehr wichtig – sie brauchen echte, väterliche Männer, die Christus lieben, zu Vorbildern. Keine „viri probati“, aber solche, denen man zutraut, sie hätten es durchaus werden können, wenn nicht ihre Liebe zum Herrn stärker gewesen wäre.
8. Jugendliche ansprechen: Viele Jugendliche haben vielleicht eine Priesterberufung, aber keine Ansprechpartner, die ihnen Amt, Auftrag und Würde des Priestertums aus eigener Erfahrung nahebringen. Hochglanzflugblätter sind sinnlos, mögliche Kandidaten schon früh zu erkennen und individuell zu beraten ist hingegen sinnvoll.
9. Entbürokratisierung: Der Priester sollte sich aufs Kerngeschäft konzentrieren – Sakramente, Seelsorge, Katechese. Für Bürokratie hat man Angestellte, gerade in einem an Finanzmitteln und Bürokratie so reichen Land wie Deutschland, wo man solche braucht und sie sich auch leisten kann. Wer Buchhalter werden will, braucht dafür nicht zölibatär zu leben. Also sollten Priester nicht Buchhalter sein müssen.
10. Katholizität der Seminare: Wer wirklich die Kirche liebt und seine Berufung zum Priester ernst nimmt, so wird zuweilen gesagt, der komme im heutigen Priesterseminar nicht weit. Frömmigkeit, grundsolide (vorzugsweise scholastische) Theologie und Philosophie, die tägliche Messe usw. sind notwendig, sowohl um das Seminar für ernsthafte Seminaristen attraktiv zu machen als auch um gute Priester im Seminar heranbilden zu können.
NACHTRAG: Alipius hat mich in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht, dass ich einen ganz zentralen Punkt vergessen habe: Hier ist er.
11. Gebet um Priesterberufungen in allen Gemeinden: Wer nicht fragt, dem wird auch nicht geantwortet.
Soweit mein ziemlich spontaner Zehnpunkteplan (inzwischen mehr als zehn Punkte! – siehe Nachtrag!) auf den Quengelaufruf von Kurienkardinal Grocholewski, über den auf kath.net berichtet wurde. Der Kardinal meint, die Problematik des Priestermangels sei den ach so antikatholischen Medien in die Schuhe zu schieben. Mag ja alles sein. Doch die Medien können wir nicht direkt ändern und sie tragen in noch viel stärkerem Maß zur Schrumpfung der Gläubigenzahlen bei, so dass dies an dem Verhältnis der Priesterzahl zur Zahl der aktiven Gläubigen nichts ändert, oder den Priestermangel vielleicht gar mildert.
Fällt Ihnen noch mehr ein, was man für Priesterberufungen tun könnte? Scheuen Sie sich nicht, Ihre Meinung zu sagen und Vorschläge zu machen. Ideen sammeln schadet nie – man weiß nie, wann man sie überraschenderweise umsetzen oder an den Mann bringen kann!